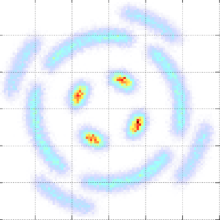Präsenzvorlesung; wir empfehlen die aktive Teilnahme im Hörsaal. Tipp: Verstecken Sie sich nicht zu Hause, im Wohnheim oder in der Cafeteria, sondern geben Sie Ihrem selbstgewählten Studienfach die Aufmerksamkeit, die es nun mal braucht. Tauschen Sie sich mit ihren Kommilitonen/-innen, Dozenten und Tutoren direkt im Hörsaal "in echt" aus. Warum eigentlich nicht...? Und klar, darüber hinaus stehen sowohl Video-Aufnahmen (nicht bei allen Vorlesungen) als auch kommentierte Versionen des Skriptes zur Vorlesung bzw. Übung für Sie auf ILIAS bereit.
Synopsis
Die digitale Übertragung von Information ist essenzieller Bestandteil aller heutigen Kommunikationssysteme, sei es Radio/TV-"Rundfunk", die Kabel-Breitbandkommunikation (Kabel-Fernsehen, DSL etc.), der Mobilfunk oder die optische Nachrichtentechnik. Diese Vorlesung behandelt ausführlich die Grundlagen der Zeit-/Frequenzbereichs-Impulsformung, der Modulation beim Sender und Detektion beim Empfänger, angepasst auf das jeweilige physikalische Übertragungsmedium (Kupferkabel, Glasfaser, Funkkanal).
Inhalt und Lernziele
Vorlesung 1: Abtasttheorem
1.1. Übersicht, Abtastung und Rekonstruktion
1.2. Zeitdiskretisierung durch Abtastung
1.3. Zurück zu Zeitkontinuität durch Rekonstruktionstiefpass
1.4. Effekte von Unter- und Überabtastung
1.5. Von reellen zu komplexen Zeitsignalen
Vorlesung 2: Quantisierung
2.1. Übersicht
2.2. Quantisierungskennlinien
2.3. Quantisierungsrauschen
2.4. Quantisierung normalverteilter Abtastwerte
2.5. Quantisierungsrauschen im Frequenzbereich
2.A. Appendix
Vorlesung 3: Impulsformung und Nyquist-Kriterium
3.1. Eine erste (PCM) Übertragungsstrecke
3.2. Übertragung von Impulsen über Tiefpasskanäle
3.3. Nachbarimpulsbeeinflussung
Betrachtung im Zeitbereich, Darstellung im Augendiagramm
3.4. Erstes Nyquist-Kriterium im Zeitbereich
Beispiel eines Nyquist-Impulses: Raised Cosine, Augendiagramme
3.5. Erstes Nyquist-Kriterium im Frequenzbereich
3.A. Appendix
Vorlesung 4: Puls-Amplituden Modulation (PAM)
4.1. PAM-Konstellationen und Impulsformung
Amplitudenstufen und Normierung, Zeitimpulse und Augendiagramm
Konstellationsformung („Constellation Shaping“), PAM-Signale im Frequenzbereich
4.2.Modellierung von Rauscheffekten
AWGN-Kanal, Signal-Rausch-Abstand, Wahrscheinlichkeitsdichten am Kanalausgang
Signal und Rauschen im Frequenzbereich
4.3. Beispiele aus der Praxis
1000BASE-T (Gigabit Ethernet), PCI Express 6.0
4.A. Appendix
Partial Response Impulsformung
Vorlesung 5: Symbol-Fehlerwahrscheinlichkeit der PAM
5.1. Zusammenhänge aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung
5.2. Allgemeiner Ansatz für zweistufigeModulation
Unipolare Symbole, Bipolare Symbole
5.3. Ansatz für M-PAM
Vorlesung 6: Amplitudenmodulation
6.1. Analoge Zweiseitenband(ZSB)-AM
Betrachtung des Zeitsignals beim Sender, Betrachtung im Frequenzbereich (Spektrum)
Demodulation beim Empfänger
6.2. Frequenzmultiplex
6.3. Digitale Übertragung mit PAM im Bandpass
6.4. Beispiele aus der Praxis
Mittelwellenrundfunk, Frequenzmultiplex bei Hausinstallation
Vorlesung 7: Einseitenband-AM und Frequenzmodulation
7.1. Einseitenband-AM
Frequenzbereichsbetrachtung, Rücktransformation in den Zeitbereich
Hilbert-Filter, Anwendung der ESB-AM in der Praxis
7.2. Frequenzmodulation, Frequenzumtastung, M-FSK
Zeitsignal der analogen Frequenzmodulation, Spektrum der analogen Frequenzmodulation
Digitale FM: M-FSK, M-FSK mit orthogonalen Impulsen, Anwendungen der M-FSK in der Praxis
7.A. Appendix
Übersicht, Besselfunktion, Spektrum der unipolaren PAM
Vorlesung 8: Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)
8.1. Bandpass-Signale in reeller und komplexer Darstellung
8.2. Demodulation von QAM-Signalen
8.3. QAM im reellen Basisband
8.4. Digitale QAM im komplexen Basisband
Zeitsignal der Impulsfolge, Konstellationsdiagramme, Ortskurven
Empfänger für digitale QAM
Vorlesung 9: Symbol-Fehlerwahrscheinlichkeit der digitalen QAM
9.1. Bandpassrauschen
9.2. Berechnung der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit
9.3. Betrachtung der QPSK
9.4. Übersicht der Symbolfehlerwahrscheinlichkeiten
9.5. Weitere Qualitätsmaße der digitalen Übertragung
Mittleres Fehlerquadrat, EVM, Transinformation
Vorlesung 10: Sender-/Empfänger-Unzulänglichkeiten
10.1. Rauschen
10.2. Phasenoffset
10.3. Frequenzoffset
10.4. Abtastzeitpunkte
10.5. IQ-Imbalance
10.6. Weitere Effekte
Vorlesung 11: Taktrückgewinnung (Timing Recovery)
11.1. Ursachen und Auswirkungen eines Abtastzeit-Offsets
11.2. Zeitsignal, Überabtastung und Interpolation
11.3. Autokorrelation des Empfangssignals
11.4. Optimale Abtastzeitpunkteinstellung
Vorbetrachtungen, Gardner-Tracking, Diskussion im S-Diagramm
Squared Gardner-Tracking, Zero Crossing-Tracking
Mueller Müller-Tracking
11.5. Schlussbemerkungen
11.A. Appendix
Autokorrelation von verrauschten Signalen
Vorlesung 12: Bandspreizung (Spread Spectrum) und Code-Multiplex (CDMA)
12.1. Prinzip der Bandspreizung
Sender, Kanal, Empfänger
12.2. Anforderungen an die Spreizsequenzen
Autokorrelation, Kreuzkorrelation, Spezielle Sequenzen
12.3. Mehrbenutzer-Betrieb mit Code-Multiplex (CDMA)
Vorlesung 13: Mehrträgermodulation, Orthogonaler Frequenzmultiplex (OFDM)
13.1. Grundprinzip
13.2. Von Einträger- zu Mehrträgermodulation
Ein Träger, Zwei Träger
13.3. Sender für Mehrträgermodulation
Vorlesung 14: Sender und Empfänger für OFDM
14.1. Empfänger für OFDM
14.2. Übergang zu zeitdiskreter Signalverarbeitung
Betrachtung eines einzelnen OFDM-Symbols, Inverse diskrete Fourier-Transformation (iDFT)
Modulation, Demodulation in Vektorschreibweise
Zeitdiskrete Implementierung
14.3. Weitere Anmerkungen
Visualisierung der Fourier-Matrix, Schutzintervall (Cyclic Prefix)
14.4. Beispiele aus der Anwendung
Hinweis: Die Kursinhalte werden ständig aktualisiert, um der technisch-wissenschaftlichen Weiterentwicklung gerecht zu werden.
Information
6 ECTS Credits (Lehrsprache ist Deutsch)
Vorlesung
| Lehrer | Prof. Dr.-Ing. Stephan ten Brink |
| Uhrzeit | Dienstag, 9:45-11:15 |
| Raum | V47/02/2.314 |
| SSW | 2 |
Übungen
| Lehrer | Marvin Rübenacke, Moritz Fischer und Paul Bezner |
| Uhrzeit | Mittwoch, 8:00-9:30 |
| Raum | V47/02/2.314 |
| SSW | 2 |